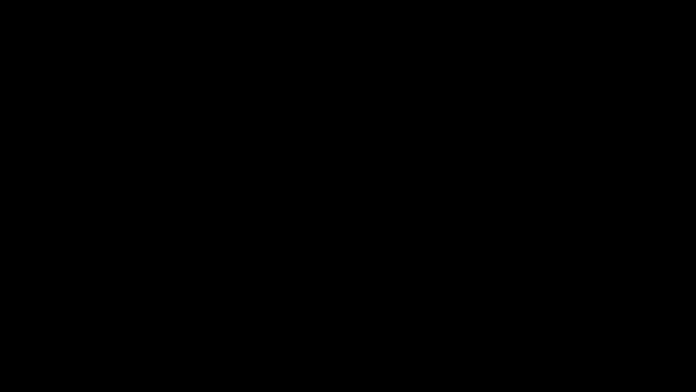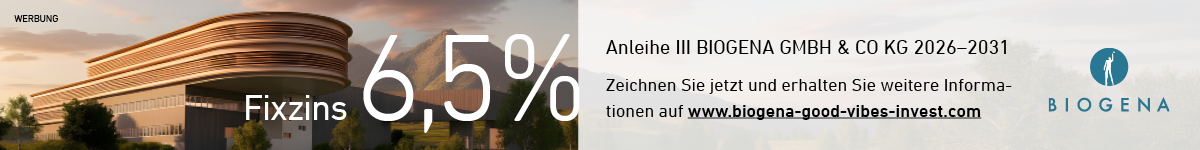Es passiert ganz plötzlich. Ampeln erlöschen, Internet und Mobilfunk fallen aus, Elektrogeräte funktionieren nicht mehr, Straßen- und U-Bahnen bleiben stehen – es wird dunkel. Innerhalb weniger Sekunden kommen so gut wie alle Strukturen des täglichen Lebens kettenreaktionsartig zum Stillstand. Und der hochvernetzten Gesellschaft wird ihre Abhängigkeit von einem System vor Augen geführt, das unsichtbar im Hintergrund arbeitet: der Stromversorgung.
Das Szenario kommt vielen bekannt vor. Marc Elsberg hat in seinem Bestseller „Blackout“ eindrücklich beschrieben, wie rasch sich ein Ausfall des Stromnetzes zur europäischen Katastrophe auswachsen könnte. Fiktion freilich – und doch nicht so weit weg von der Realität, wie ein großflächiger Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel vor wenigen Monaten zeigte.
Am 28. April fiel die öffentliche elektrische Energieversorgung in Spanien und Portugal komplett aus. Mehr als zwölf Stunden standen Teile der Infrastruktur still, der Verkehr kam ins Stocken, hunderttausende Haushalte waren ohne Strom. Zu einer dramatischen Eskalation wie bei Elsberg kam es zwar nicht – ein Weckruf war die Großstörung allemal.
Bessere Vernetzung
Aus diesem Anlass rückte das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ), das Jahr für Jahr gemeinsam mit der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien einen Sicherheitsgipfel veranstaltet, heuer das Thema Blackout in den Fokus. Ende November versammelten sich zahlreiche Experten im Raiffeisenhaus, um über Auswirkungen und Maßnahmen zu diskutieren.
Innere Sicherheit sei kein singuläres Thema, betonte der frühere Innenminister und KSÖ-Vizepräsident Karl Schlögl, es gehe nicht nur um die Vermeidung von Kriminalität, sondern auch um soziale und wirtschaftliche Sicherheit sowie die Versorgungssicherheit. „Wir sind in einem hohen Ausmaß von Strom abhängig und unsere Gesellschaft muss, wenn solche dramatischen Vorfälle eintreten, auch entsprechende Vorsorge treffen und Antworten geben können“, so Schlögl. In der Vorbereitung geschehe in fast allen Institutionen, Unternehmen und auch einzelnen privaten Haushalten bereits viel, meinte Innenminister Gerhard Karner und verwies auf rund 200 Polizeidienststellen, die im Ernstfall völlig autark seien. Luft nach oben gebe es jedoch in der Vernetzung der Maßnahmen, weshalb Veranstaltungen wie der KSÖ-Sicherheitsgipfel umso wichtiger seien.

„Der gesamte europäische Netzbetrieb ist volatiler und schlechter planbar geworden.“
Gerhard Christiner
Strukturelle Probleme
Der Blackout in Spanien und Portugal war der größte Stromausfall im kontinentaleuropäischen Verbund seit über 20 Jahren. Anders als frühere großflächige Störungen wurde er nicht durch eine Überlastung, sondern durch einen Überspannungskollaps ausgelöst, erklärte Gerhard Christiner, Vorstandsvorsitzender des österreichischen Übertragungsnetzbetreibers APG (Austrian Power Grid). Spanien verfügt über deutlich höhere zulässige Spannungswerte (bis zu 435 kV) als der europäische Standard von rund 420 kV, was das System anfälliger mache.
Als es gegen Mittag zu Erzeugungsausfällen in Photovoltaik- und thermischen Anlagen kam, stieg die Spannung an. Christiner stellte dar, wie innerhalb von nur 15 Sekunden mehrere Hochspannungswerke vom Netz gingen, die Frequenz absackte und sich Spanien schließlich vom europäischen Verbund entkoppelte. Die Ursache sei nicht ein einzelner Fehler gewesen, sondern ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren. So hat Spanien etwa beim Ausbau von erneuerbaren Energien vereinfachte Netzanschlussbedingungen gewährt, diese aber in den letzten Jahren nicht an die neuen Herausforderungen eines volatilen Systems angepasst. Vorbildlich sei dafür der Netzwiederaufbau mit schwarzstartfähigen Kraftwerken gewesen. Dennoch zeige der Vorfall: „Wir sind in Europa nicht so sicher, wie wir glauben“, warnte Christiner.
Er nahm den Blackout – an dessen Aufarbeitung APG beteiligt ist – auch zum Anlass, die strukturellen Schwächen des europäischen Stromsystems offenzulegen. Mit der Energiewende befinde sich Europa mitten in einer Transformation, die sich primär auf der Erzeugungsseite abspielt. Wurden 2015 noch rund 180 Gigawatt aus Photovoltaik und Wind generiert, sind es heuer rund 470 Gigawatt. „Erneuerbare Energien führen zu dynamischen europaweiten Stromflüssen“, so Christiner, wodurch der Netzbetrieb schlechter planbar geworden sei. Eine hohe Erzeugungsvolatilität treffe auf starres Verbrauchsverhalten. Um Versorgungssicherheit zu garantieren, brauche es ein funktionierendes Zusammenspiel von ausreichend Kraftwerkskapazitäten, Netzinfrastruktur und Systemdienstleistungen wie Frequenz- und Spannungshaltung. Besonders im Netzbereich liege die größte Schwachstelle Europas: Leitungen würden oft erst Jahre später fertig als Wind- oder PV-Parks, die jedoch längst einspeisen wollen. „Unkoordinierte strukturelle Veränderungen bringen Risiken in das System“, mahnte Christiner.

Klare Prioritäten setzen
Naemi Loibl, Chief Security Officer bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, berichtete in einer Podiumsdiskussion von keinen direkten Auswirkungen des iberischen Blackouts. Die Häufung von Störungen zeige jedoch, wie wichtig klare Prioritäten seien. Unternehmen müssten wissen, welche Prozesse unbedingt aufrechterhalten werden müssen – und diese Szenarien auch üben. „Passieren kann immer etwas, aber man muss vorbereitet sein“, so Loibls Credo.
Christian Zeindlhofer, Head of Group Risk and Resilience bei A1, warnte davor, die Verwundbarkeit durch die Digitalisierung zu unterschätzen. Ohne funktionierende Kommunikation sei auch keine Krisenkoordination möglich: „No coordination without communication.“ Übung sei entscheidend – alles andere im Ernstfall „Glücksspiel“. Zudem erinnerte er an die Verantwortung jedes Einzelnen: „Je weniger wir in Krisensituationen als Einzelne Hilfe benötigen, desto resilienter sind wir als Gesellschaft.“
Chaos im öffentlichen Verkehr
Die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Spanien und Portugal waren unzureichend auf den Blackout vorbereitet, wie Lena Schwarz, Senior-Fachkoordinatorin für Krisenmanagement bei den Wiener Linien, schilderte. Metro und Tram blieben stehen, wo sie gerade waren, viele Züge in Tunneln oder zwischen Stationen. Stationssprechanlagen, Aufzugsnotrufe, teilweise Notrufzentralen, elektronische Schlüsselsysteme und die GPS-Ortung der Fahrzeuge fielen aus. Gleichzeitig führte der Ausfall der Ampeln zu extremen Staus: In Lissabon brauchte man für drei Kilometer bis zu vier Stunden. Auch kam die Information, dass es sich um einen weitreichenden Blackout handelt, erst spät; gleichzeitig kursierten Falschmeldungen, dass ganz Europa finster sei.
Als wichtigste Lektionen nannte Schwarz unter anderem die Wiedereinführung von Satellitentelefonen – die zuvor aus Kostengründen eingespart worden waren –, den Ausbau der Notstromversorgung, klare Anweisungen und Erreichbarkeitskonzepte für Mitarbeiter sowie die kritische Bedeutung redundanter Systeme. Dieselgeneratoren mussten teils etwa erst herbeigeschafft werden und Aufzüge hatten keine automatische Bergefahrt. Positiv hob sie hervor, dass es keine ernsthaften medizinischen Zwischenfälle und kaum Kriminalität oder Vandalismus gab. Das Engagement der Mitarbeiter sei bemerkenswert gewesen – manche Fahrer blieben bis zu zwölf Stunden bei ihren Fahrzeugen.
Die Wiener Linien sind laut Schwarz besser vorbereitet: mit einem Blackout-Handbuch, detaillierten Maßnahmenplänen pro Fachbereich und einem dreiphasigen Modell für den Ernstfall. Satelliten-Infrastruktur, 200 Notfallbetten und 2.200 Verpflegungsrationen für vier Tage stehen zur Verfügung, Mitarbeiter werden regelmäßig geschult. Durch fünf Schiffsgeneratoren könne die Notbeleuchtung aller Stationen mindestens 72 Stunden aufrechterhalten werden. Oberste Priorität habe das Zugsicherungssystem – wenn dieses einmal down ist, dauere die Wiederinbetriebnahme vielfach länger: „Dann müssen wir jede einzelne Weiche im Netz abgehen und deren Status der Leitstelle bekannt geben. Und wir haben sehr viele Weichen“, so Schwarz.

„Bei einem aggressionsgetriebenen Blackout funktioniert von dem, was wir planen, gar nichts.“
Peter Vorhofer
Zeithorizont erweitern
Im zweiten Panel stand das staatliche Sicherheits- und Krisenmanagement im Fokus. Bundesfeuerwehrpräsident Robert Mayer stellte klar, dass man sich bei einem Blackout auf die Menschenrettung konzentrieren müsse. Wichtig sei, die eigenen Kräfte zu sensibilisieren: „Nur wer weiß, dass die eigene Familie versorgt ist, wird einsatzfähig sein.“ Ähnlich wie Zeindlhofer forderte er realistische Erwartungen: „Die Bevölkerung wird einen wesentlichen Teil zur Bewältigung leisten müssen.“
Deutliche Worte fand Peter Vorhofer, oberster Krisen- und Sicherheitsberater der Bundesregierung. Ein Blackout sei ein „soziotechnischer Krisenfall“, bei dem die Möglichkeit eines Kaskadeneffekts groß sei. Man müsse zwischen einer rein technischen Ursache und einem gezielten Angriff unterscheiden: „Wenn uns ein aggressionsgetriebener Blackout ins Haus steht, funktioniert von dem, was wir planen, gar nichts.“ In einem hybriden Angriffsszenario könnte jedes Wiederhochfahren gezielt gestört werden. Durchhaltepläne für drei Tage greifen deshalb aus Vorhofers Sicht zu kurz: „Was ist nach diesen 72 Stunden, wenn es sich technisch nicht lösen lässt oder ein neuartiges Problem auftritt, das wir nicht kennen?“ Er plädierte dafür, über diesen Zeithorizont hinaus auch Krisensituationen durchzudenken, die mindestens eine Woche dauern. Der Gipfel zeigte, dass Resilienz vor allem dort entsteht, wo automatische Krisenmechanismen und redundante Kommunikationswege bereitstehen sowie regelmäßige Übungen stattfinden. Einig war man sich, dass auch die Bevölkerung Teil der gemeinsamen Vorsorge sein muss. Wer im Ernstfall handlungsfähig bleiben will, muss Vorkehrungen treffen – bevor die Lichter ausgehen.