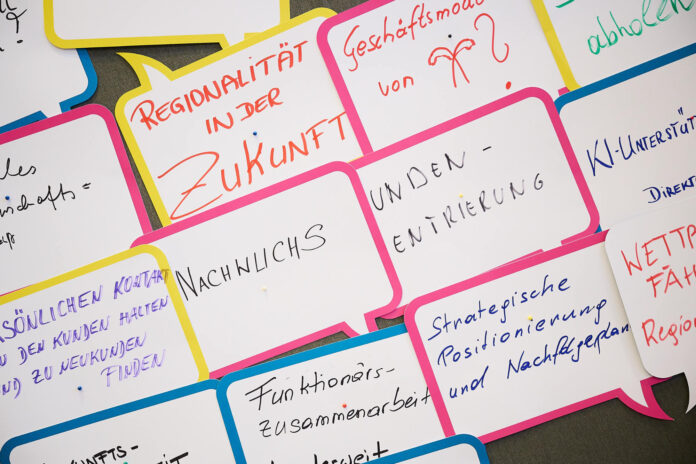Mit der Ausbildung zum Spitzenfunktionär ist es in einer sich ständig verändernden Welt nicht getan: Wer die Entwicklung seiner Genossenschaft aktiv mitgestalten will, braucht den kontinuierlichen Austausch – über aktuelle Rahmenbedingungen, neue Trends und innovative Ansätze im Sektor.
Hier setzt das Funktionärsforum des Raiffeisen Campus an: Was als Lern- und Vernetzungsformat für „Kompetenz plus“-Absolventen begann, hat sich zu einem Fixpunkt im Kalender entwickelt und feierte heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Anfang November bot das Funktionärsforum rund 110 Teilnehmern aus ganz Österreich über zwei Tage eine kompakte Bühne für Orientierung und Dialog – von Aufsicht und Politik bis zu Geopolitik, Zukunftsfragen und gelebter Genossenschaft.
Austausch mit der Aufsicht
Zum Auftakt gab Roland Salomon, stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute bei der FMA, einen Überblick über regulatorische Rahmenbedingungen. Zwar schrumpfe die Anzahl der Banken, zugleich wachse Österreichs Bankenmarkt mit einer Gesamtbilanzsumme von über 1,3 Billionen Euro stetig. Auch bei Raiffeisen schreite der Strukturwandel voran: „Die ganz kleinen Banken verschwinden immer mehr, die Großen werden immer größer“, sagte Salomon und verwies auf mittlerweile knapp 30 Raiffeisen-Primärbanken mit einer Bilanzsumme von über einer Milliarde Euro.
Für 2025 nannte Salomon Resilienz und Stabilität mit besonderem Fokus auf Kredit- und Immobilienrisiken als zentrale Prüfschwerpunkte. Auch Digitalisierung, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Fragen der Governance habe man im Blick. So wolle die FMA etwa verstehen, wie Banken neue Technologien wie KI einsetzen, um früher oder später Erwartungshaltungen formulieren zu können.

Gleichzeitig sprach sich Salomon für eine Effizienzsteigerung der Regulatorik aus – ohne dabei in Richtung Deregulierung zu gehen. „Komplexe Vorgaben, die niemand mehr versteht, sollte man vereinfachen, aber etablierte Standards dürfen nicht aufgeweicht werden.“
Bei den Immobilienkrediten an private Haushalte zeigte sich Salomon „agnostisch“: Die KIM-Verordnung laufe aus, weil kein systemisches Risiko mehr bestehe. In der gewerblichen Immobilienfinanzierung hingegen gebe es Handlungsbedarf – Ausfälle bei Projekten, insbesondere in Wien, hätten gezeigt, wie wichtig regionales Know-how und Risikobewusstsein seien. „Sie haben als regionaler Versorger ein positives Asset, das sie weitertragen und noch mehr stärken sollten“, betonte Salomon.
Zukunftsvisionen nötig
Dieses Unterscheidungsmerkmal von Raiffeisen strich auch Johannes Rehulka, Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbands, heraus: „Es ist eine wunderbare Geschichte, dass Menschen Mitinhaber ihrer regionalen Bank werden können.“ Es sei jedoch nötig, dies angesichts mehrerer Herausforderungen noch besser im unmittelbaren Kundenkontakt zu vermitteln. Rehulka sprach von „ungemeinem regulatorischem Druck“, steigenden Kosten im IT- und Personalbereich sowie hoher Erwartungshaltung der Kunden.
Trotz dieser Rahmenbedingungen zeigte sich der Generalsekretär zuversichtlich: Den Marktanteil von Raiffeisen von über 30 Prozent gelte es nicht nur zu verwalten, sondern auszubauen. „Dafür braucht es Zukunftsvisionen und Investitionen“, betonte Rehulka. Der Sektor müsse sich mit der rasanten KI-Entwicklung beschäftigen und trotz dezentraler Struktur schneller Entscheidungen treffen: „Wenn wir uns mit neuen Dingen proaktiv und ohne Angst auseinandersetzen, dann mache ich mir gar keine Sorgen.“

„Emokratie“ statt Demokratie
Weniger Optimismus versprühte Politikberater Thomas Hofer in seinen Ausführungen über die politische Lage. Es sei ein Denkfehler, zu sagen, „wir müssen durch die Krise“. Dadurch werde suggeriert, dass danach wieder alles so werde wie vorher. Tatsächlich befinde sich die Gesellschaft längst in einer Vielzahl von Krisen – von der Migration über den Klimawandel bis hin zu den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen.
„Viele Themen kommen von außen und schwappen wie eine Welle über Land, Parteien und Regierung“, erklärte Hofer. Weil die Politik tagesaktuell mit unterschiedlichsten Problemen beschäftigt sei, könnten kaum Ressourcen für mittel- bis langfristige Strategien vorgehalten werden. Statt Agenda Setting sei nun „Agenda Surfing“ an der Tagesordnung, die Politik also nur mehr als Passagier externer Faktoren anstatt selbst in der Gestaltungsrolle. Mit gravierenden Folgen: „Wenn ich das Gefühl habe, dass es niemanden gibt, der eine Idee davon hat, wohin es gehen soll, entsteht ein Gefühl von Kontrollverlust, was wiederum zu einem Vertrauensverlust in die Demokratie führt.“

Hofer verwies auf das Konzept der „Emokratie“ – eine Demokratie, in der Emotionen anstelle von Fakten die politische Debatte dominieren. Emotionen hätten zwar immer eine Rolle gespielt, heute jedoch lösten sie sich zunehmend von der Ebene der Zahlen, Daten und Fakten: „Wir sind nicht die rational denkenden Geschöpfe, die wir glauben zu sein. Emotion kann auch ohne faktische Basis existieren und erfolgreich sein“, sagte Hofer, Donald Trump sei das beste Beispiel. Damit einhergehe eine zunehmende Intoleranz gegenüber anderen Meinungen und eine Polarisierung: „Wenn es Ängste vor Wohlstandsverlust gibt, gerät die Identität unter Druck. Dann suchen Menschen Antworten an den politischen Rändern.“
Nähe sei die Währung der Zukunft – Aspekte, mit denen genossenschaftliche Organisationen punkten können. Hofer forderte eine positive Zukunftserzählung und verwies auf die Strategie der Triangulation von Bill Clinton, um eine übergeordnete Position zu zwei Gegenpositionen zu finden: „Zwischen ‚System weg‘ und ‚alles ist gut‘ muss es etwas dazwischen geben.“
Geopolitische Spannungen
Wie eng wirtschaftliche und politische Entwicklungen verflochten sind, machte RBI-Chefökonom Gunter Deuber deutlich: „Die Wirtschaft ist oft die letzte Spielwiese vor einer militärischen Konfrontation.“ Schon immer sei Wirtschaft ein Teil von Geopolitik gewesen, „wir hatten nur eine längere Phase relativer Ruhe“, so Deuber. Diese Ruhe sei mit der russischen Invasion in der Ukraine vorbei gewesen. Seither habe sich die Welt in zwei große Blöcke geteilt – rund 60 Prozent der Staaten beteiligten sich an den Sanktionen gegen Russland, der Rest, angeführt von China, verfolge eigene wirtschaftliche Interessen.
China sei zwar einer der wichtigsten Handelspartner Europas, zugleich aber immer weniger vom Außenhandel abhängig – eine Entwicklung, die Deuber auch als strategische Vorbereitung auf künftige Konflikte wertete: „In einem Konfliktfall wird China viel mehr produzieren können als Europa und die USA.“ Für Banken bedeute das eine wachsende Verantwortung in den Bereichen der Resilienz und Cybersicherheit. „Banken und Finanzsysteme zählen zu den potenziellen Angriffspunkten, um Gesellschaften zu destabilisieren“, warnte Deuber.

Trotz aller Risiken ortete der RBI-Ökonom aber auch Chancen für Europa und Österreich: etwa in der Stärkung regionaler Wertschöpfung, in der sanktionskonformen Begleitung von Unternehmen im Auslandsgeschäft sowie in neuen Kooperationen in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
Netzwerke nutzen
Auf eine abstraktere Ebene blickte Christiane Varga. Die Zukunfts- und Trendforscherin sieht die Herausforderung darin, dass sich Dinge immer schneller verändern: „Wir leben in einer komplexen Welt, die immer komplexer wird.“ Entgegen eines landläufigen Spruchs sei früher nicht alles besser, aber übersichtlicher gewesen.
Zukunft, so Vargas zentrale Botschaft, sei keine ferne Linie, sondern eine Gemeinschaftsangelegenheit, die im Dialog gestaltet werden müsse. „Zukunft gehört demokratisiert“, betonte sie – jede und jeder könne dazu beitragen, indem man Fragen stellt. Dafür brauche es auch Offenheit: „Wenn man sich Zukunft räumlich vorstellt, liegt sie vorne und oben. Aber durch dieses lineare Denken sehen wir die Möglichkeiten rechts und links nicht.“ Es gebe nicht nur eine Zukunft: „Je nachdem, wohin wir gehen, realisiert sich die eine oder die andere“, erklärte Varga.
Ihre Lösungsstruktur für die Zukunft ist das Netzwerk. So könne man lernen, die Komplexität der Welt zu wertschätzen, statt sie zu fürchten: „Wir sind von einem großen Möglichkeitsraum umgeben. Es gibt unzählige Schnittstellen, die es nur gilt, zu entdecken und zu verknüpfen.“

Impulse für den Sektor
Die vielfältigen Aspekte der genossenschaftlichen Struktur rückten am zweiten Tag des Funktionärsforums in den Mittelpunkt. Helmut Kern, Leiter des Geschäftsbereichs Strategie bei der Raiffeisenlandesbank OÖ, stellte das Projekt „Attraktivierung Miteigentümerschaft“ vor. Dessen Ziel ist, mehr Kunden als aktive Mitglieder zu gewinnen und den Nutzen der Beteiligung sichtbarer zu machen – etwa durch neue Kommunikationsformen und digitale Sichtbarkeit in ELBA oder ein eigenes Kartendesign.
Das Konzept versteht sich als Impuls für den gesamten Sektor: Miteigentümerschaft nicht nur als rechtliche Form, sondern als Ausdruck von Identifikation, Verantwortung und regionaler Verbundenheit.
Wie dieser Gedanke in der Praxis umgesetzt wird, zeigten mehrere Raiffeisenbanken mit unterschiedlichen Zugängen. Die Raiffeisenbank Perg präsentierte eine erfolgreiche Mitgliederkampagne mit Magazin, Ideenwettbewerb und regionalen Förderaktionen, die zu einem deutlichen Plus bei neuen Miteigentümern führte. Die Raiffeisenbank Region Amstetten setzt auf emotionale Bindung durch Mitgliederfeste und Vorteilsprogramme, während die Raiffeisenbank Kitzbühel-St. Johann Nachhaltigkeit und Regionalität in den Mittelpunkt stellt.