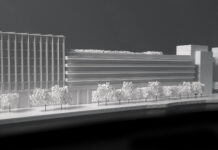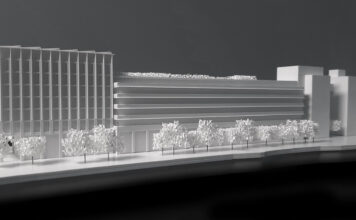„Der Kärntner LeiLei is mast lustig und frei“, schrieb der Villacher Dichter Hans Tschebull in einem Gedicht zum Fasching im Jahr 1906. Bekannt gewesen sein dürfte der Begriff des „Leilei“ – was so viel wie Tölpel, Tolpatsch oder Narr bedeutet – jedoch bereits davor. Der Begrüßungsruf der Villacher zur sogenannten fünften Jahreszeit ist bei weitem nicht der einzige, der zur Faschingszeit in Österreich erschallt. Die Palette reicht von der Spittaler Version „He-Lei“ übers Jedlersdorfer „Urli urli“ bis hin zum im 12. Wiener Gemeindebezirk innerhalb der Faschingsgilde üblichen „Mei-Mei“. Mit seinen typischen und regional unterschiedlichen Narrenrufen steuert das närrische Treiben traditionsgemäß in jenen Tagen vor dem Aschermittwoch (heuer am 13. Februar) seinem Höhepunkt entgegen.
Tolle Fastenzeit
Warum gerade diese Zeit dazu auserkoren wurde, um, wie es umgangssprachlich heißt, „die Sau rauszulassen“, liegt im Beginn der Fastenzeit begründet. Schon im Begriff des Karnevals, der sich laut Forschern vom lateinischen Carnislevamen oder Carnisprivium ableiten lässt und so viel wie Fleischwegnahme heißt, lassen sich die bevorstehenden Einschränkungen der Fastenzeit ablesen.
Und auch der österreichische Fasching nimmt vom mittelhochdeutschen Wort „vast-schanc“ (Ausschank und Trunk vor der Fastenzeit) kommend Bezug auf die 40-tägige Zeit vor Ostern. Verboten waren ab Aschermittwoch nicht nur Fleisch, sondern auch Schmalz, Fett, Milch, Butter, Käse und Eier – was beispielsweise die Tradition des beliebten Faschingskrapfens, der damals noch als Resteverwertung diente, erklärt. Das heißt: Bevor die Speise- und Trinkgewohnheiten komplett geändert werden mussten, kam es nochmals zur reichlichen Nahrungsaufnahme und zum ungehemmten Alkoholgenuss. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert tat man dies verstärkt bei öffentlichen Gelagen.
Mit der Zeit gesellten sich Schaubräuche wie die Verballhornung des mittelalterlichen ritterlichen Lebensstils durch Handwerksburschen oder die Errichtung eines Narrenstaates hinzu. Repräsentative Umzüge mit Maskengestalten und allegorischen Vorführungen erfreuten sich ab dem Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit verstärkter Beliebtheit. Stand bei den Umzügen zunächst noch die Figur des Teufels im Mittelpunkt, so begann ihm mit der Zeit der Narr langsam den Rang abzulaufen.
Verkehrte Welt
Seinen Auftritt hatte die Figur des Narren jedoch bereits wesentlich früher. Bereits in der Antike stößt man auf ihn als Spaßmacher und Grimassenschneider. Überlieferungen sprechen zudem von Festen mit karnevalesken Zuständen, bei denen es üblich war, eine „verkehrte Welt“ auszurufen. So wählte man beispielsweise im alten Rom während der Saturnalien einen König, der mit seinen sinnlosen Befehlen für Heiterkeit sorgte.
Ein Brauch, der auch im Mittelalter Verbreitung fand. In vielen Gemeinden und Städten war es üblich, einen „Narrenbischof“ zu küren. Vor allem für den niederen Klerus galten solche Narren- oder Eselsfeste als Ausgleich zum ansonsten von strengen Regeln gestalteten Leben. Mancherorts fanden Prozessionen statt, in die die Orts- beziehungsweise Stadtbewohner eingebunden wurden und bei denen es für unseren heutigen Geschmack zu äußerst derben Vorkommnissen wie Entkleidungen und dem Werfen mit Kot gekommen sein soll. Dass die Obrigkeit beziehungsweise Geistlichkeit nicht immer mit dem bunten Treiben einverstanden war, zeigen Überlieferungen von Versuchen, derlei Feste einzudämmen.
So verurteilte beispielsweise das Baseler Konzil die Einsetzung von Narrenbischöfen, -königen und -fürsten und sprach sich damit gegen den Missbrauch aus, der so in gewissen Kirchen getrieben wurde. 1274 tritt beispielsweise auch die Salzburger Provinzialsynode vehement gegen solche Veranstaltungen auf. Erst im 16. Jahrhundert gelang es Kirche und weltlicher Macht, die ärgsten Exzesse und Ausschweifungen zu unterdrücken und den Brauch in relativ geordnete Bahnen zu lenken. Man begann die Fastnacht beziehungsweise die Faschingszeit, wenn auch nicht als kirchliches Fest, so doch in untrennbarem Zusammenhang mit der Fastenzeit zu setzen.
Das Modell für die Rechtfertigung des närrischen Treibens lieferte niemand Geringerer als der heilige Augustinus mit seiner Zwei-Staaten-Lehre, in der er die Welt in eine göttliche, die „civitas dei“, und eine vom Teufel regierte, die „civitas diaboli“, teilte. Die während dieser Tage herrschenden Zustände zeigten nichts anderes als die menschliche Natur, die in diesem von Teufel und Narr regiertem Staat dem Untergang, letztendlich dem Tod, geweiht sei. Die Wochen der Fastenzeit verdeutlichen hingegen den Aufbruch Richtung himmlisches Jerusalem. Es sei der Unwissende, der Narr, der die Existenz Gottes leugne. Passend dazu heißt es in Psalm 53 im Buch der Psalmen: „Dixit insipiens in corde suo: non est deus (Der Narr sprach in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott).“
Vom Teufelsreich ins Theater
Illustrationen zum Psalm finden sich ab dem frühen 13. Jahrhundert in Form eines (wie in der Antike) kahlköpfigen Narren. Erst im 15. Jahrhundert haben wir mit der kapuzenartigen Kopfbedeckung, der Gugel, die im Laufe der Zeit eine Überzeichnung erfährt und sich zur Eselsohrenkappe wandelt, das Bild des Narren vor uns, wie es uns heute vertraut ist – ausgestattet mit Narrenszepter (Marotte) und Schellen und bekleidet mit einem farbenfrohen Kostüm, das vertikal in zwei Farben (Mi-Parti) unterteilt wurde.
Im bunten Flickenkostüm eroberte der Narr mit der Commedia dell’arte ab dem 16. Jahrhundert von Italien ausgehend den europäischen Raum. In seiner Rolle als Hofnarr und mit dem sich langsam aus dem Fastnachtsspiel herauslösenden Drama fiel ihm am Hof und als Bühnenfigur unter dem Deckmantel der Narrenfreiheit die höhere Aufgabe zu, so manche Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft zu geißeln. Nicht umsonst besagt ein altes Sprichwort doch: „Narrenmund tut Wahrheit kund.“ Darüber lässt sich freilich heute nach wie vor trefflich streiten.