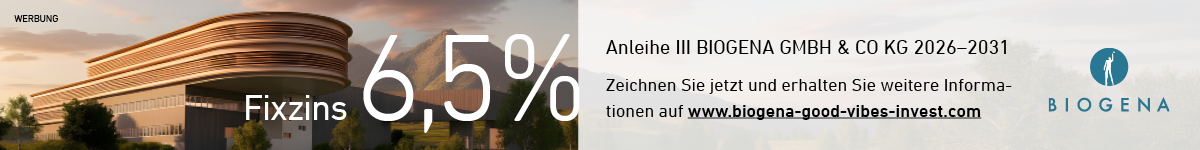Der Wunsch vom Eigenheim ist ungebrochen. Wohntraum Nummer eins der Österreicher ist ganz klar das Einfamilienhaus. Und obwohl die Gründe rar sind, das Bauen empfindlich teurer und die Finanzierung schwierig geworden ist, gilt nach wie vor das Motto: „Wer kann, der baut“, weiß Julia Lindenthal vom Österreichischen Ökologie Institut. Sie hat im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse (RBSK) eine Bestandsaufnahme basierend auf die Registerzählung 2021 durchgeführt und das Thema „Klimaschutz im Wohntraum Nummer 1“ untersucht.
Ihre Ergebnisse zeigen, dass der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser am Gebäudebestand gegenüber der letzten Registerzählung 2011 leicht um 2 Prozent gesunken ist, doch die Anzahl der neuerrichteten Ein- und Zweifamilienhäuser steigt (2011: 14.024, 2021: 16.370). Davon entfallen 64,5 Prozent auf Einfamilienhäuser. Insgesamt wurden zwischen 2011 und 2021 rund 187.000 Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet.
Mindernutzung steigt
„Die klassische Kernfamilie lebt nicht mehr in einem Einfamilienhaus“, sagt Lindenthal. Paare mit mindestens einem Kind leben im Schnitt nur mehr zu 35 Prozent in Einfamilienhäusern und zu 29 Prozent in Zweifamilienhäusern. Rund 297.000 Häuser werden nur mehr von einer Person bewohnt, etwa 435.000 von zwei Personen. Das sind zusammen 57 Prozent aller Einfamilienhäuser.
Seit 2011 ist die Zahl dieser mindergenutzten Häuser gestiegen: Damals wurden knapp 46 Prozent der Einfamilienhäuser nur von ein bis zwei Personen bewohnt. In Wien und in Burgenland liegt der Anteil der Einpersonenhaushalte in Einfamilienhäusern sogar bei 27,7 bzw. 27 Prozent. „Das ist sogar schon höher als der dortige Anteil an Paaren mit mindestens einem Kind unter 25 Jahren“, betont die Studienautorin.
Die Ergebnisse spiegeln aber auch die Lebensphasen wider: „Je jünger das Objekt, desto geringer ist der Anteil der Zweipersonenhaushalte, desto größer der Anteil der klassischen Kernfamilie“, macht Lindenthal aufmerksam.
Seniorenhaushalte – in denen sind alle Haushaltsmitglieder 65 Jahre oder älter – haben im Vergleich zu 2011 ebenfalls zugenommen: 2021 fallen in diese Kategorie bereits 303.000, das sind 23,8 Prozent aller Privathaushalte mit Hauptwohnsitz im Einfamilienhaus, eine Zunahme um 4 Prozent.
Häuser werden größer
Die Bestandsaufnahme zeigt zudem, dass die Wohnfläche pro Kopf seit den 1970er-Jahren kontinuierlich zunimmt. Das liege zum einen daran, dass die Häuser immer größer werden, und zum anderen daran, dass die größere Fläche von immer weniger Personen bewohnt und genutzt wird, so Lindenthal. 2022 lag die Wohnfläche pro Kopf über alle Gebäudetypologien hinweg bereits bei 46,6 m2. „Der Wert wird durch den Wiener Schnitt von 37 m2 etwas gedrückt“, weiß Lindenthal und verdeutlicht: „Beispielsweise im Burgenland liegt der Wert bereits bei 55,8 m2 pro Kopf.“
Ein- und Zweifamilienhäuser haben 2021 eine durchschnittliche Nutzfläche von 128,7 m2, durchschnittlich 5,9 Räume und wurden von 2,1 Personen bewohnt. Das entspricht 60,3 m2/Kopf. Gegenüber 2011 hat sich die Nutzfläche um 7,6 m2 vergrößert, sind 0,5 Räume dazugekommen und wohnen 0,2 Personen weniger in einem Einfamilienhaus.

Geändertes Mindset
„Der Flächenfraß geht weiter“, sagt Lindenthal. Alleine im Jahr 2022 wurden 43,8 km2 in Anspruch genommen, davon wurden 55 Prozent versiegelt. 6,7 km2 wurden neu bebaut, davon 2,7 km2 mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Das Ziel, die Flächeninanspruchnahme bis 2030 auf maximal 9 km2 pro Jahr zu reduzieren, werde laut Lindenthal „meilenweit verfehlt“.
Würde man den Fokus verstärkt auf Sanierung und Renovierung des Altbestandes legen, ließe sich der Flächenverbrauch besser eindämmen. Dem Thema Sanierung haftet aber ein fader Beigeschmack an: zu teuer, zu kompliziert, zu mühsam. Und es stimmt, ein Neubau lässt sich schneller und leichter planen, durchrechnen und finanzieren. Alleine die Beratung für Sanierung und entsprechende Förderungen benötigt mindestens den doppelten Aufwand im Vergleich zu einem Neubau, weiß Christian Vallant, Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse (RBSK), und scherzt: „Sanierung ist eigentlich ein Hobby, das muss man sich antun wollen.“
Nichtsdestotrotz hat sich die Anzahl der vergebenen Darlehen für Sanierungen/Renovierungen sowie Um- und Zubau seit 2020 beinahe verdoppelt. Gründe dafür sind mitunter die geänderten Rahmenbedingungen: gestiegene Zinsen, hohe Inflation und damit auch Bau- und Finanzierungskosten sowie strengere Kreditvergaberegeln.
Allerdings auch eine Veränderung im Mindset, sagt Vallant: „Laut einer 2023 von uns beauftragten und vom Marktforschungsinstitut Spectra durchgeführten repräsentativen Studie geben fast drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher (konkret 72 Prozent) dem Renovieren und Sanieren den Vorzug gegenüber einem neu zu bauenden Haus. Das bedeutet eine signifikante Steigerung von drei Prozentpunkten gegenüber der Messung in 2021. Das zeigt uns, wie viel Potenzial in diesem Thema -sowohl klimapolitisch als auch wirtschaftlich -steckt.“
Falsche Tendenz
Und wenn man wirklich will, kann jedes Einfamilienhaus in Österreich zur Halbierung seines Energiebedarfs saniert werden, sagt Lindenthal. Der restliche Bedarf kann mit erneuerbarer Energie gedeckt werden. „Bis zu 75 Prozent an Förderung gibt es dafür von der öffentlichen Hand. Noch nie zuvor war der Umstieg auf Erneuerbare so sinnvoll. Er verschafft uns Unabhängigkeit und sorgt für Klimaneutralität“, bekräftigt die Studienautorin.
Obwohl der Stellenwert von Sanierungen in den letzten Jahren zwar gestiegen ist, geht die Tendenz aber in die falsche Richtung: Die Gesamtsanierungsrate betrug für das Jahr 2022 österreichweit nur 1,4 Prozent, 2011 waren es noch 2,1 Prozent. Die geförderten umfassenden Sanierungen stagnieren nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau von unter 0,4 Prozent.
„Am Weg zur Klimaneutralität führt kein Weg an der Sanierung vorbei“, unterstreicht Lindenthal abschließend. Als Grundlage brauche es eine ressourcenschonende Raumordnung und „Bestandsentwicklung vor Neubau“ müsse zum zentralen Leitprinzip werden. Entscheidend wäre zudem der Abbau von Finanzierungsbarrieren bei Sanierungsprojekten beziehungsweise ein generell leichterer Zugang zu Sanierungsförderungen. Zusätzlich spricht sich die Studienautorin für die Einführung einer Basisförderung für Beratungen im Vorfeld von Planungen aus.