Selten stellt sich Johann Strobl, CEO der Raiffeisen Bank International, so bereitwillig Fragen von Journalisten abseits von Bilanzveröffentlichungen. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine war er erstmals wieder im Klub der Wirtschaftspublizisten, um über die aktuelle Lage der Bank und die Situation in der Ukraine und Russland zu sprechen. „Unser Themenkreis ist breit und der Blick auf die RBI aufgrund der Entwicklungen gar kein einfacher“, betont Strobl eingangs. „Die RBI ist in geopolitischen Spannungen gefangen“, so Strobl.
In der Ukraine sei die Situation „unvorstellbar schwierig“. Wenn sich ein Land derart lange im Krieg befindet, dürfe man sich nicht täuschen lassen, wenn Mitarbeiter und Kunden sagen „sie kommen damit zurecht“. Die Leistung der mehr als 5.000 Kollegen in der Ukraine sei deshalb nicht hoch genug anzurechnen. „Wir haben auch, anders als sonst in Krisensituationen der Fall, das Kreditgeschäft nicht eingestellt, sondern ausgeweitet“, berichtet Strobl. Das Ergebnis vor Steuern ist im ersten Halbjahr um 2,2 Prozent auf 141 Mio. Euro gestiegen. Auch technisch sei die Bank in einem sehr guten Zustand, so könne etwa bei Unterbrechung der Stromversorgung, der Bankbetrieb trotzdem aufrechterhalten werden. „Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand und Frieden haben auch die Wiederaufbau-Initiativen deutlich beflügelt“, schildert Strobl.
Rückzug aus Russland
Im Gegenzug hat die RBI ihre Aktivitäten in Russland so weit wie möglich zurückgefahren. Seit Beginn des Angriffskriegs wurden in Russland keine neuen Kredite mehr vergeben. Das Kreditportfolio ist von 13,7 Mrd. Euro im Halbjahr 2022 auf nunmehr 4,7 Mrd. Euro „abgereift“. Auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden hat die Bank im ersten Halbjahr 2025 weiter reduziert. „Nach Kriegsbeginn gab es einen starken Einlagenzufluss. Wir wirken dem entgegen, indem wir keine Zinsen zahlen“, erklärt der CEO. Dadurch habe es auch erhebliche Abflüsse gegeben, aber deutlich weniger als erwartet. Im Zahlungsverkehr gibt es ebenfalls deutliche Restriktionen. „Unsere Systeme sind sehr gut, sodass es keine Sanktionsumgehungen geben kann“, betont Strobl. Ein „minimales Angebot“ müsse man allerdings aufrechterhalten.
Neben der weiteren Reduzierung der Geschäftstätigkeit läuft die Suche nach einem Käufer für die russische Bank weiter. „Wir bleiben weiter dran und geben nicht auf, einen Käufer zu finden. Es gibt noch einige auf der Liste“, berichtet Strobl. Dass die Zahl der Interessenten hoch ist, wundert den Generaldirektor nicht, darf doch der Kaufpreis für die Bank maximal bei der Hälfte oder weniger liegen. Die Verkaufsbemühungen haben 2023 begonnen, aber noch ist es nicht gelungen, einen Käufer zu finden, „der für alle als akzeptabel eingestuft wurde“, erklärt Strobl. Alle, das sind in diesem Fall die Russen – bis hinauf zu Präsident Putin –, die europäischen Behörden und auch die US-amerikanische Sanktionsbehörde OFAC. Bis dato habe man zweimal kein grünes Licht bekommen. Die Kommunikation mit allen Behörden sei intensiv. „Ich habe neue Aspekte in meinem Berufsleben kennengelernt, aber ich bin noch immer Banker und nicht Diplomat oder Politiker“, gibt Strobl einen Einblick in sein Tagesgeschäft.

Eine Sanktionshürde
Aktuell hofft der RBI-Chef auch weiter auf eine Ausnahmeregelung bei den Russland-Sanktionen der EU, die es ermöglichen würde, einen Teil des in Russland eingefrorenen Vermögens herauszuholen. Ein russisches Gericht hat die Raiffeisenbank Russland nach einer Klage der russischen Rasperia zu einer Strafzahlung von 2,1 Mrd. Euro verurteilt. Rasperia wird dem sanktionierten russischen Unternehmer Oleg Deripaska zugerechnet. Gleichzeitig stellte das Gericht der russischen RBI-Tochter in Aussicht, die im Rasperia-Besitz befindlichen Strabag-Anteile übernehmen zu können. Dies war der Bank jedoch bisher nicht möglich, da die Aktien unter EU-Sanktionen eingefroren sind. Strobl kann sich „nicht erklären, wo die Bedenken sind. Ich habe das bisher nicht verstanden.“ Das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland wird aktuell intensiv verhandelt und muss einstimmig von den Mitgliedstaaten beschlossen werden.
Sollte der RBI eine Ausnahmeregelung bei den Sanktionen verweigert werden, hat Strobl auch einen Plan B, der allerdings nicht ohne Risiko ist: Sollte ein österreichisches Gericht die Rasperia zu einer Schadenersatzzahlung an die RBI verurteilen, könnte das Gericht die Strabag-Aktien sanktionskonform verwerten, um die RBI zu entschädigen. Dann drohen der RBI aber Strafen in Russland. Strobl zeigt sich in dem Zusammenhang zwar zuversichtlich, dass ein österreichisches Gericht im Sinne der RBI entscheiden würde, „wünschenswert oder zu erwarten“ wäre aber eine Ausnahmeklausel bei den Sanktionen, um die Verwertung der Strabag-Aktien zu ermöglichen.
Wachsender Kernkonzern
Johann Strobl nutzt jede Gelegenheit, um auch über die Situation des Kernkonzerns, also der RBI ohne Russland, zu berichten: „Wir haben eine nachhaltige Ertragskraft. Die RBI ist eine sehr gute Bank.“ Kräftige Ertragssteigerungen im Kernkonzern kompensieren die Vorkriegsbeiträge von Russland und Belarus. Vor allem der westliche Balkan habe in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung gezeigt und auch die Zinssituation habe geholfen.
Die Investitionszurückhaltung der Firmenkunden dürfte ebenfalls langsam drehen. „Es wird besser, das stimmt uns zuversichtlich für die nächsten Jahre.“ Gute Entwicklungen seien auch im Privatkundenbereich zu verzeichnen, aber hier ortet die Bank noch viel Potenzial. „Wir brauchen mehr Kunden, damit wir wachsen können“, erklärt Strobl und ergänzt: „Der heilige Gral des Cross-Selling existiert nicht mehr.“ Es gehe vielmehr um den Aufbau mentaler und physischer Verfügbarkeit: Kunden sollen in mehr Alltagssituationen an Raiffeisen denken, aber dann auch über alle Vertriebskanäle leicht zu finden sein.
Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen, setzt die RBI aktuell auf das neue Geschäftsfeld „Digital Assets“ und innovative Banklösungen mit KI-Unterstützung. Nach anfänglicher Zurückhaltung bei Krypto-Assets plant die RBI im ersten Halbjahr 2026 die erste Emission eines Gold-Token. Weiters ist die RBI dem EU-weiten Bankenkonsortium zur Emission eines Stablecoins beigetreten – einer Art Parallelentwurf zum geplanten Digitalen Euro der EZB. „Banken können das im bestehenden System deutlich schneller und besser lösen.“ Strobl erklärt: „Die neuen Möglichkeiten ergeben sich aus dem Regelwerk MiCAR. Die Zeit ist jetzt auch reif für traditionelle Banken und nicht nur für Fintechs und Start-ups.“

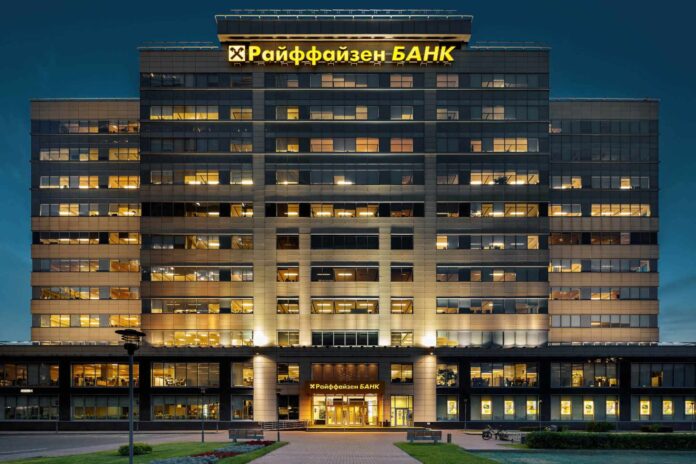









Gefangen in geopolitischen Ereignissen? Raiffeisen hat sich 2007 entschieden, Deripaska Anteile an der Strabag zu verkaufen. Der Background von Deripaska und Putin spielte dabei keine Rolle, statt dass man diesen Deal lieber nicht machte.